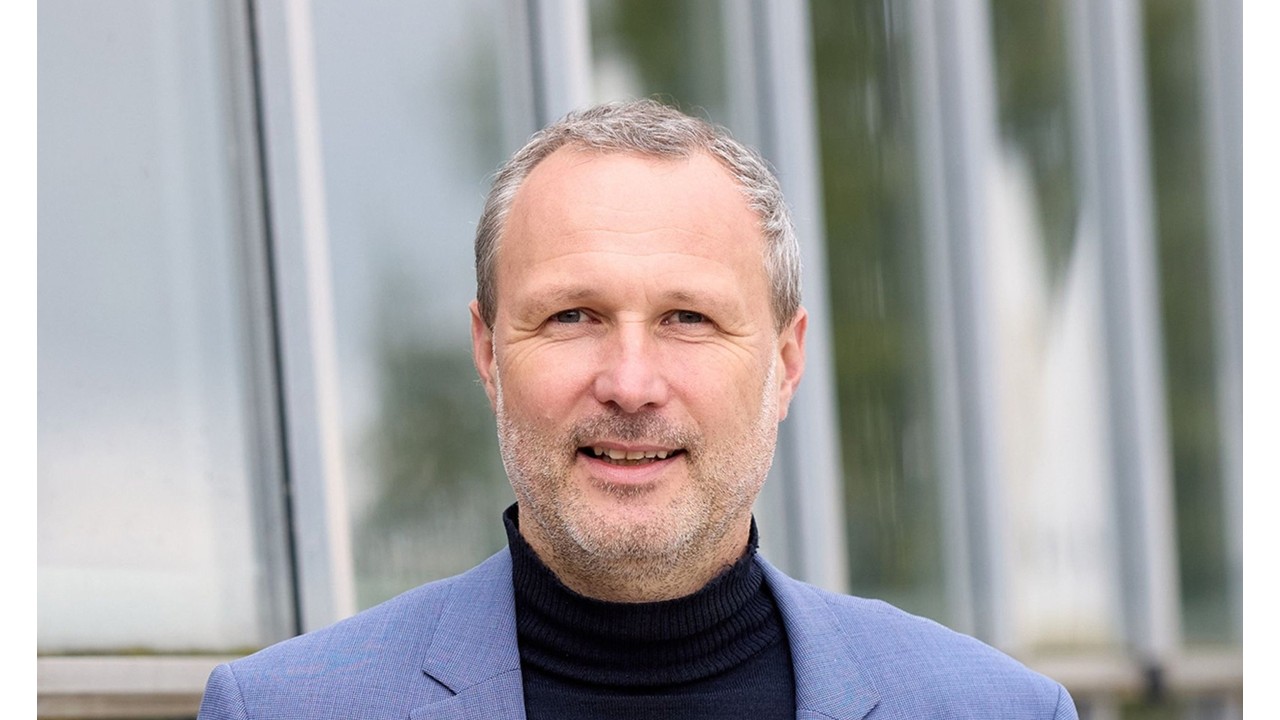Patrick Jahn ist ausgebildeter Krankenpfleger. Er studierte Pflege- und Gesundheitswissenschaft in Hamilton (Kanada) und Halle (Saale), wo er 2011 promoviert wurde. Seit 2020 ist Jahn Professor für Versorgungsforschung und Pflege im Krankenhaus an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und leitet die AG Versorgungsforschung – Pflege im Krankenhaus im Department für Innere Medizin der Universitätsmedizin in Halle (Saale). 2024 wurde er in die Fachkommission nach dem Pflegeberufegesetz berufen.
Welche neuen, digitalen Technologien und technischen Anwendungen stehen in der Pflege heute schon zur Verfügung?
Prof. Patrick Jahn: Diese Frage berührt zwei Aspekte: Nämlich, was gibt es schon? Und wo geht die Reise hin? Schon im Einsatz haben wir in vielen Bereichen eine vollständig digitale Dokumentation. Auch im Bereich der Sensorik haben sich Alarmsysteme für Sturz oder Bettausstieg bereits etabliert. Televisiten werden auch schon in einzelnen Einrichtungen angeboten.
Bei Zukunftstechnologien wie Robotik, VR oder auch KI-Systeme ist die Anwendung deutlich geringer. Wir machen sehr gute Erfahrungen mit den Large-Language-Models wie ChatGPT als Sprachassistenz im pflegerischen Alltag. Entsprechend haben wir damit auch schon Erfahrungen gesammelt und können sagen, dass es eine große Erleichterung ist, im Zweifel schnell auf Übersetzungstechnologie zurückgreifen zu können. Erstens, weil es im Alltag selten schnell genug gelingt, eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher aufzutreiben, wenn nicht gerade Pflegepersonal mit entsprechenden Erst- oder Zweitsprachen im Dienst ist. Und zweitens, weil wir mit LLMs so viel mehr Sprachen abdecken können. Aber mir ist auch wichtig zu sagen, dass so eine Unterstützung nicht die Nähe-Interaktion mit Patientinnen und Patienten ersetzt, die manchmal nötig ist. Da helfen auch freundlich designte Roboter nichts – wir benutzen zum Beispiel TIAGo® von PAL Robotics; auch Pepper von SoftBank ist in diesem Bereich populär.
Aber wenn es um spezielle Beratung oder auch tröstende Worte geht, dann brauchen wir zweifelsohne das direkte Gespräch. Die Technologien ermöglichen dennoch Entlastung in der Routine, und wir bekommen damit mehr Freiräume für das unersetzbare, persönliche Gespräch.
Eine andere verfügbare Technologie sind Drohnen, beispielsweise zur schnellen Medikamentenlieferung innerhalb der Palliativversorgung auf dem Land. Davon abgesehen unterstützen KI-basierte Systeme auch die Dokumentation, durch Spracheingabe, z. B. in der Anwendung voize. Die Dokumentation in der Pflege ist ein Bereich, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Durch Spracheingabe kann der Zeitaufwand merklich verkürzt werden. Und es gibt immer noch Potenzial. In Halle entwickeln wir im BMFTR-geförderten Verbund „TPG“[1]mit AR-Dashboard eine neue Lösung, die auf Augmented Reality, also erweiterte Realität, basiert. Dabei wird die Information – etwa zur aktuellen Medikation – nicht über einen Laptop oder Tablet angezeigt, sondern direkt in das Gesichtsfeld der Pflegefachperson in der konkreten Pflegesituation. Das kann über eine Brille geschehen oder eine Projektion, bspw. auf eine Wand. Die Pflegefachperson hat dadurch beide Hände frei und die Information dort, wo sie sie braucht.
Auch für die Schnittstelle zwischen Pflege und medizinischer Versorgung tun sich neue Möglichkeiten auf. Ich denke hier an Telepflege und ein Projekt, das wir in der Translationsregion für Digitale Pflege („TDG“) deutschlandweit einmalig realisiert haben: Die Digitale Residenzpraxis („DRP“). In einer Einrichtung in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) konnte ganz praktisch die sogenannte Heilkundeübertragung erprobt werden. Dabei wurde in zwei Pflegeheimen eine durch eine Pflegefachperson geleitet Praxis etabliert, die digital mit den Hausärzten, aber auch mit der Uniklinik bei der Wundversorgung verbunden war. So konnten Informationen schneller geteilt werden, die Behandlungen untereinander besser abgestimmt und für die Bewohnerinnen und Bewohner Fahrten eingespart werden. An den Ergebnissen der Studie sehen wir: Das Angebot wird ausgesprochen gut angenommen und verbessert, auch nach Einschätzung der Beteiligten, die Behandlung.
Pflegeeinrichtungen, gerade im ländlichen Raum, sind für die Versorgung etwa von Diabetes oder chronischen und schlecht heilenden Wunden auf Hausärzte angewiesen, die aber nicht jederzeit in die Einrichtung kommen können. Hier können entsprechend qualifizierte Pflegende, Absolventinnen und Absolventen unserer Medizinischen Fakultät etwa, auch eigenständig mehr Aufgaben übernehmen.
Auch nach der Studie wird die Versorgung an einem Standort direkt fortgeführt. Es braucht aber dringend weitere klare Rahmenbedingungen, wie es durch das neue Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege jetzt endlich durch den Bund auf den Weg gebracht wird.
Und dann vielleicht noch eine Technologie, die wir bundesweit erstmalig auch in Halle seit Kurzem pilotieren: die radargestützte und kontaktlose Erfassung von Bewegungs- und Vitaldaten. Hier arbeiten wir mit dem israelischen Start-up Neetera zusammen. Im Moment kann ein kleiner Sensor, der sieht ein bisschen aus wie ein Babyphon, neben Bettausstieg und Bewegung im Bett auch Puls, Herzfrequenzvariabilität und Atmung erfassen. Künftig sollen damit zusätzlich Parameter wie Blutdruck erfassbar sein. Diese Erfassung ist komplett kontaktlos über eine Distanz von 1,5 bis 2 m möglich und kann in gängige Stationssysteme eingespeist werden. Und sie ist auch in der eigenen Häuslichkeit möglich.
Und wo/in welchen Bereichen kommen neue/digitale Technologien ganz konkret zum Einsatz?
Prof. Patrick Jahn: Momentan kommen die meisten Lösungen stationär zum Einsatz. Das hat auch damit zu tun, dass Systeme noch in der Testphase sind und mit einem soliden Studiensetting erprobt werden. In Süd-Sachsen-Anhalt haben wir die einzigartige Situation, im Rahmen der Medizininformatik Initiative und in Kooperation mit unserem Datenintegrationszentrum einen Digitalhub für Pflegedaten aufbauen zu können („Care:ecoHUB“), in dem Nutzungsdaten aus Einrichtungen in der Region zusammenlaufen und dann auch für die Forschung zugänglich sind. Damit werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, Entwicklungen in die Fläche zu bringen. Dafür braucht es ein Innovationsnetzwerk – und das schaffen wir hier – in dem Hersteller, Entwickler, Einrichtungen und Nutzende voneinander profitieren und lernen können.
Und dann können Anwendungen perspektivisch auch ambulant und in der Häuslichkeit eingesetzt werden.
Ambulant Pflegende und pflegende Angehörige müssen auf dem Weg dahin natürlich auch mitgenommen werden, und letztlich haben sie alle auch Ideen und Vorschläge für Problemlösungen. Deswegen gehören beide Gruppen auch mit zum Innovationsnetzwerk.
Welche technischen/technologischen Anwendungen können für Entlastung sorgen – bei Bewohnerinnen und Bewohnern eines Pflegeheims und beim Pflegepersonal?
Prof. Patrick Jahn: Bei Bewohnerinnen und Bewohnern geht es eher um die Unterstützung/Begleitung für mehr Selbstständigkeit. Sensoren, wie jener von Neteera, erleichtern auch Bewohnerinnen und Bewohnern den Alltag, weil keine Kabel mehr am Bett hängen und so etwas wie nächtliches Aufstehen automatisch registriert wird. Das ist ja auch eine mentale Entlastung.
Die Studie zur „DRP“ zeigt eindrücklich: Bewohnerinnen und Bewohner schätzen die Versorgung durch die Pflegepersonen, und die engmaschigere Betreuung wirkt sich positiv auf den Behandlungsprozess aus. Und schließlich können Bewohnerinnen und Bewohner auch von Übersetzungen profitieren, weil sie Bedürfnisse mitteilen können, die sonst vielleicht unter den Tisch gefallen oder nicht im richtigen Moment adressiert worden wären.
Beim Pflegepersonal sorgen technologische Anwendungen für Unterstützung und schaffen Gestaltungsmöglichkeiten. Für mich hängt das zusammen:
Wo Unterstützung möglich ist, steigen die Gestaltungsmöglichkeiten.
Ob das die Übersetzung ist oder der Sensor oder Patienteninformationen, die direkt zur Verfügung stehen. Am tiefsten greift sicherlich die durch „DRP“ erweiterte Versorgung ein. Das ist geradezu ein Paradebeispiel dafür, wie der Handlungsspielraum von Pflegefachpersonen durch digitale Möglichkeiten erweitert wird.
Wie kann man Pflegepersonal erfolgreich und ohne Vorbehalte an neue Technologien heranführen bzw. wie kann die Akzeptanz erhöht werden?
Prof. Patrick Jahn:
Insgesamt ist es zentral, dass neue Technologien für die Pflege auch von der Pflege kommen.
D. h., dass Pflegende in allen Schritten der digitalen Transformation eingebunden sein müssen und diese auch selbst mit steuern und initiieren können. Meist ist es ja nicht nur die Technologie, sondern auch die Betrachtung der Folgen für den Arbeitsprozess. Das beginnt bei der partizipativen Technologieentwicklung, geht über die Sensibilisierung und Schulung zu dem transformativen Potenzial der Digitalisierung und neuen Möglichkeiten der Versorgung und endet schließlich in der souveränen Nutzung der neuen Technologien. Ist die Beteiligung und Aktivierung auf die geschilderte Art gewährleistet, so entstehen laut unseren Umfragen keine Akzeptanzprobleme. Als übergreifende Aufgabe bleibt nichtsdestoweniger das Thema Schulung, um das Pflegepersonal für die beschriebenen Aufgaben zu qualifizieren und mitzunehmen. Hierbei ist entscheidend, dass die Veränderungen der Digitalisierung nicht rein technologisch sind, sondern einen umfassenden organisatorischen Change-Management-Prozess bedingen, der mit einem Kulturwandel einhergeht. D. h., neben der Vermittlung des technischen Know-hows bedarf es u. a. Inhalte des Projektmanagements oder auch der Kommunikation im Team. Die Art der Schulungskonzepte kann dabei sicherlich variieren und sollte an die Voraussetzungen der Teilnehmenden angepasst sein. An der Universitätsmedizin Halle bieten wir als umfassendes Schulungskonzept die berufsbegleitende Weiterbildung „Beratende für digitale Gesundheitsversorgung” an, die mittlerweile über 150 Teilnehmende schulen konnte, die als Multiplikatoren und Veränderungsbegleiter in den Einrichtungen fungieren und als solche auch im Kollegium wahrgenommen werden. Sachsen-Anhalt ist das erste Bundesland, dass hier eine strukturierte und umfängliche Weiterbildung bietet und damit Pflegefachpersonen und Einrichtung auch dadurch im digitalen Wandel unterstützt..
Und wie muss sich die Ausbildung in der Pflege anpassen, um für neue Technologien und sich verändernde Prozesse gewappnet zu sein?
Prof. Patrick Jahn: Das Thema Qualifizierung berührt grob zwei Bereiche. Die Weiterbildung bereits ausgebildeter Fachkräfte und die Integration digitaler Kompetenzen in die Rahmenlehrpläne der Länder, die natürlich auch durch die Lehrkräfte entsprechend umgesetzt werden müssen. Das bedeutet, die Ausbildung beginnt schon früher, nämlich bei den Lehrkräften, die Zugang zu Technologien bekommen und Erfahrung im Umgang mit ihnen aufbauen können. Am Ende geht es aber neben digitalen Kompetenzen auch um die bereits erwähnten Fähigkeiten, damit eine neue Pflegeversorgung zu gestalten.
Digitalisierung ist ein Querschnittsthema, das alle Bereiche betrifft und für pflegerische Versorgungssettings entsprechende Handlungskompetenz voraussetzt.
Für die Ausbildung bedarf es neuer Lernorte, die die Digitalisierung erfahrbar werden lassen. So können die Auszubildenden den Umgang mit neuen Technologien – etwa digitalen Dokumentationssystemen, Telemedizin, Robotik oder KI-gestützten Entscheidungshilfen – praxisnah in Future Care Labs erlernen. Eine entsprechende Verbindung von Theorie und Praxis ist in diesem Bereich zentral. Denn es ergibt keinen Sinn, Tools zu entwickeln, die im Pflegealltag niemand braucht. Daraus folgt, dass Lernprozesse auf Selbstreflexion und Anpassungsfähigkeit ausgerichtet sind, ganz im Sinne des transformativen Lernens, um Veränderungen aktiv mitzugestalten. Dies kann bspw. gefördert werden durch gemeinsames Reflektieren in der Gruppe zu den Veränderungen, die mit der Digitalisierung zu erwarten sind. Das gilt gleichermaßen für die grundständige Ausbildung wie für die berufsbegleitende Qualifikation.
Welche Schwerpunkte müssen daher aus Ihrer Sicht in der Pflegeausbildung neu gesetzt werden?
Prof. Patrick Jahn: Der eine Schwerpunkt sind, wie gesagt, transformative Ansätze. Also das Aufbauen auf Kompetenzen, Vorwissen und Erfahrung, um so die Übertragbarkeit auf den eigenen beruflichen Kontext zu ermöglichen.
Und wir müssen eine Haltung entwickeln, die heute wichtiger ist als je zuvor. Nämlich, dass sich Pflegehandeln auf wissenschaftlicher Grundlage und mit neuen Technologien konstant verändert und demzufolge auch immer neu hinterfragt wird. Insbesondere, um damit Pflegeversorgung abzusichern und zu verbessern.
Letztlich macht es keinen Sinn, von Partizipation zu dozieren, ohne das entsprechende Handwerkszeug zu liefern.
Dafür haben wir seit Kurzem das Kompetenzkolleg Partizipationsforschung und Transformation in der Gesundheitsversorgung („KPTG“). Ziele sind u. a., Forschungsprozesse mit Know-how zu unterstützen und Forschungsmethoden, die auf Teilhabe und Mitwirkung ausgerichtet sind, in die grundständige Lehre zu integrieren.
Wie sieht für Sie die ideale Pflege der Zukunft aus?
Prof. Patrick Jahn: Pflegende haben ein klares Verständnis über die Wirksamkeit ihres Handelns, übernehmen Verantwortung für die regionale Daseinsvorsorge und nutzen dafür auch die digitalen Angebote. Das geschieht nicht nur, weil sie es im Alltag sehen, sondern auch, weil ihre Methoden und Praktiken wissenschaftlich fundiert und laufend überprüft sind.
Pflege versteht sich nicht nur als ausführende Instanz, sondern auch als Gestalterin. Pflegende nehmen diesen Gestaltungsauftrag an und sehen sich in ihrer täglichen Arbeit als Gestaltende nicht nur ihres eigenen Arbeitsalltags, sondern guter Pflege insgesamt. Dann entstehen auch Gestaltungsspielräume, die wir im Rahmen der „TDG“ und „TPG“ ganz gezielt weiterentwickeln. Das ist etwas, das von Pflegenden auch heute als enorm wichtig immer wieder betont wird und das Arbeitszufriedenheit und Qualität nachweislich steigern kann.
Eine Pflege der Zukunft, wie wir sie uns vorstellen, verändert aber auch die Patientinnen und Patienten. Es geht darum, deren Selbstmanagement zu steigern und die Gesundheitskompetenz signifikant zu erhöhen. Ohne die selbstbewusste und angstfreie Nutzung digitaler Möglichkeiten ist beides kaum denkbar.
Letztlich geht es immer darum, Menschen mehr Selbstständigkeit zu geben und auf lange Sicht, Pflegebedürftigkeit bestenfalls zu vermeiden, zu lindern oder mindestens zu verzögern.
Pflege, die dazu einen Beitrag leistet, ist paradoxerweise darauf ausgerichtet, weniger notwendig zu sein. Darin liegt die fundamentale Neuausrichtung.
Besten Dank für dieses Interview.
Fotocredits: © Universitätsmedizin Halle, Carolin Unrau
[1] Die Innovationsregion für die digitale Transformation von Pflege und Gesundheit (TPG): Mit der Innovationsregion „TPG“ entsteht ein Zentrum für digitale Lösungen in der Pflege und Gesundheitsversorgung. Ziel ist es, kreative Köpfe, Pflegende, Unternehmen und Forschende miteinander zu verbinden. Gemeinsam entwickelt TPG nutzerfreundliche Technologien, welche den Alltag erleichtern für Menschen, die pflegen oder gepflegt werden. Dabei verfolgt „TPG“ einen Ansatz, der die Menschen teilhaben lässt: sie können und sollen Technologien kennenlernen, erproben und dabei unterstützen, diese in die Praxis zu überführen. Darin liegt die Überzeugung, dass sich Pflege digital bestmöglich verändern lässt und so regionale Versorgungsfragen lösen kann.